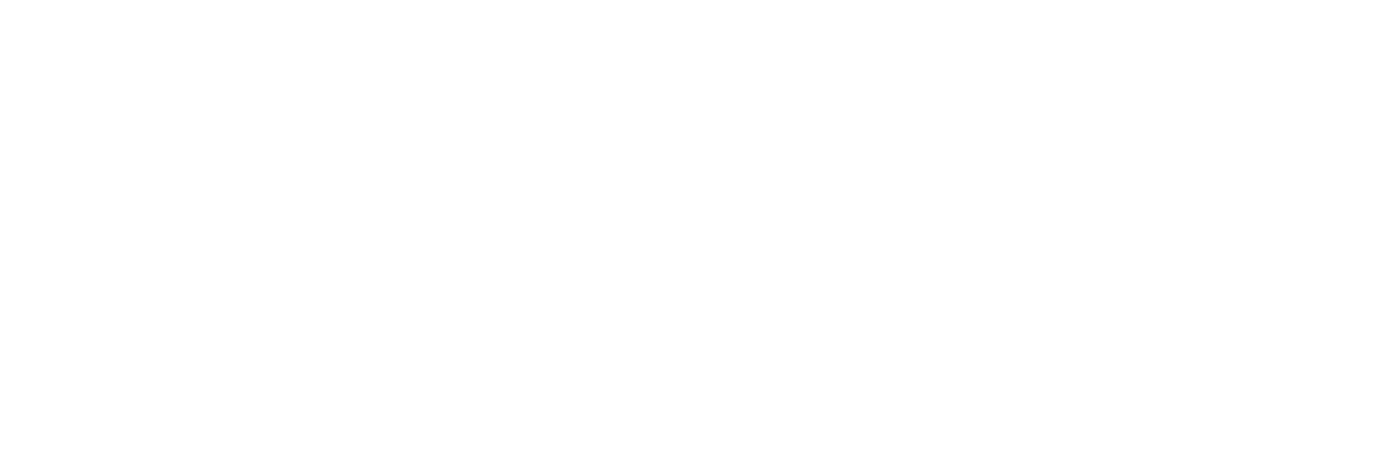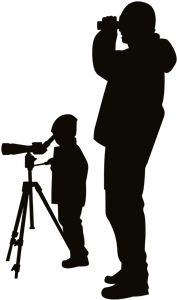Ratgeber
Jetzt ist wieder ihre Zeit. Wenn es im Frühjahr langsam warm wird, sind Schmetterlinge nicht nur in heimischen Gärten zu sehen. Viele Arten lieben den Übergang zwischen Wald und Offenland. Ganz besonders wertvoll sind deshalb lichte Waldabschnitte, mit ihren nahtlosen Übergängen zwischen blühenden Wiesen und dem Wald.
Lichte Waldabschnitte zeichnen sich dadurch aus, dass der Waldrand bewusst – und meist durch menschliche, gewollte Eingriffe – offengehalten wird und die Bäume weniger dicht stehen. Auf natürliche Weise können sogenannte „Lichte Wälder“ vor allem auf sehr mageren und trockenen Felsstandorten auftreten. Gerade sonnige, nach Süden gerichtete Hanglagen bieten sich ganz besonders an. So finden wir auch im Wehntal an der Eggseite lichte Waldabschnitte, die nicht nur Lebensraum für viele bedrohte Schmetterlingsarten sind, sondern auch für eine Vielzahl von Insekten und damit auch für viele Vogelarten. Die meist mageren Standorte bringen es mit sich, dass dort eine Vielzahl an seltenen Pflanzen zu finden ist, etwa auch heimische Orchideen.
Und damit schliesst sich der Kreis zu den Schmetterlingen. Fast alle Arten leben quasi in enger Symbiose mit einer Futterpflanze. Fehlt sie, dann wird auch die betreffende Schmetterlingsart fehlen. Zu den Zielarten gehören bei uns im Wehntal Beilfleck-Widderchen (Zygaena loti), Brauner Feuerfalter (Lycaena tityrus) und der Himmelblaue Bläuling (Polyommatus bellargus). Der Hufeisenklee (Hippocrepis comosa) sowie Bunte Kronwicke Coronilla varia dient z.B. der Raupe des himmelblauen Bläulings als Hauptnahrung. Haben Sie eine sonnige Ecke im Garten? Pflanzen Sie die Futterpflanze und vielleicht flattert schon bald ein blauer Schmetterling durch Ihren Garten. Ein Versuch ist es Wert!
Udo Fischer, Natur- und Vogelschutzverein Wehntal
Der Rotmilan - nach harten Zeiten wieder im Aufwind
Der Rotmilan ist vielleicht der eleganteste aller Schweizer Greifvögel. Mit seiner rostroten Färbung und dem langen Schwanz kann man ihn leicht bestimmen. Auch sein Ruf ist charakteristisch. Die Art ist perfekt an das Fliegen angepasst: Minutenlang kann der Rotmilan über die Felder und Wiesen segeln und nach Mäusen Ausschau halten. Er frisst aber auch Aas, Eidechsen, grosse Insekten und Regenwürmer.
Anblick ist keine Selbstverständlichkeit
Wie Bartgeier, Bär und Wolf wurde der Rotmilan im 19. Jahrhundert verfolgt, gejagt, geschossen und vergiftet. 1925 stellte man den mit einer Flügelspannweite von bis zu 1,7 Meter drittgrössten einheimischen Greifvogel – nach dem Steinadler und dem Bartgeier – unter Schutz, doch bis in die 1950er-Jahre wurde er weiterhin abgeschossen, vergiftet, seine Horste geplündert. Erst danach erholte sich die Population allmählich. Noch hat der Rotmilan nicht sein ganzes ehemaliges Brutareal zurückerobert, aber gefährdet ist er in der Schweiz nicht mehr.
In Frankreich und Spanien – beides wichtige Verbreitungsgebiete – nimmt der Bestand aufgrund von Vergiftungen und Jagd immer noch ab. Die Schweizer Exemplare machen zwischen fünf und zehn Prozent des gesamten europäischen Bestandes aus, der auf rund 20 000 bis 25 000 Brutpaare geschätzt wird.
Füttern oder nicht?
Die Fütterung von Greifvögeln hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. So gewöhnt sich auch der Rotmilan schnell an Futterstellen. Er ist ein Fleischfresser, aber bezüglich der Beute oder des Jagdhabitats überhaupt nicht wählerisch. Er gilt als sogenannter Opportunist, der jene Beute am häufigsten fängt, die am zahlreichsten vorhanden und am einfachsten zu erreichen ist. Unbestritten eine sinnvolle Strategie, welche durch regelmässige Fütterung natürlich erst recht gefördert wird.
Bei den Vögeln, welche sich in unseren Siedlungen aufhalten, handelt es sich meist um Junggesellen, die noch keine Jungen aufzuziehen haben. Rotmilane brüten nämlich erst im Alter von zwei oder sogar drei Jahren. Diese Jungvögel sind genug kräftig, um selbstständig auf Nahrungssuche zu gehen. Mit der Fütterung werden die Vögel mitten in die Wohngebiete gelockt. Fleischreste im Garten, Kotspuren oder ausgiebige Bettelrufe können dabei Nachbarn belästigen und so den guten Ruf dieser Vögel beeinträchtigen. Andererseits entsteht eine für die Vögel gefährliche Abhängigkeit, welche bei Einstellen der Fütterung, insbesondere während der kälteren Jahreszeit, zum Tod der Vögel führen kann. Folglich ist von einer Fütterung der Rotmilane abzusehen und das natürliche Verhalten dieser Tiere zu respektieren.
- Greifvogelstation Berg am Irchel: https://greifvogelstation.ch
Evelyne Güntlisberger, Natur- und Vogelschutzverein Wehntal
Kaum ist der Winter vorbei, wandern die Amphibien aus den Winterquartieren zu ihren Laichgewässern, um sich dort zu paaren. Zuerst wandern die Grasfrösche und die Erdkröten. In tiefen Lagen sind sie in regnerischen Nächten schon Ende Februar unterwegs. Führt ihr Weg über eine Strasse, werden sie oft zu Hunderten überfahren.
Damit dies nicht geschieht, werden an diesen Zugstellen die Strassenabschnitte gesperrt oder Amphibienunterführungen gebaut. An manchen Orten werden Amphibienzäune aufgestellt. Freiwillige, Schulklassen oder Gemeindemitarbeitende sammeln die Tiere ein und tragen sie über die Strasse.
Auch im Wehntal existieren auf gewissen Quartierstrassen in den Gemeinden solche Zugstellen - vor allem in Waldrandnähe. Leider ist es da nicht möglich, Strassenabschnitte zu sperren. Einzelne Freiwillige sind jeweils unterwegs und tragen Amphibien von der Strasse weg. Herzlichen Dank an dieser Stelle für Ihr Engagement!
Wir vom NVS Wehntal möchten die Autofahrer:innen bitten, auf den Quartierstrassen mit Amphibienzug umsichtig unterwegs zu sein und langsam zu fahren. Wenn Sie unter 30 km/h fahren ist das Risiko kleiner, Amphibien zu überfahren. Ebenso minimiert sich das Risiko, dass dem Tier die inneren Organe platzen, wenn es zwischen den Rädern auf der Strasse wandert.
Pestizide schwächen oder töten Amphibien
Amphibien haben eine durchlässige Haut und nehmen damit leicht Stoffe aus der Umwelt auf – leider auch Pestizide. Durch diese können sie getötet oder geschwächt werden. Zum Beispiel durch «Roundup», ein in der Schweiz verkauftes Mittel gegen Unkräuter. Auf Kaulquappen und junge Amphibien kann es tödlich wirken. Verzichten Sie deshalb in ihrem Garten auf den Einsatz von Pestiziden.
Frösche und Molche rund ums Haus
Hat es in Ihrer Nähe einen Teich? Gut möglich, dass dann rund um Ihr Haus Frösche, Molche, Kröten oder Salamander leben. Helfen Sie mit, dass es ihnen gut geht. Das Pro Natura Faltblatt «Amphibien rund ums Haus» gibt Ihnen Tipps und kann über die Homepage https://shop.pronatura.ch/collections/informieren gratis bestellt werden.
Textauszüge: ProNatura
Text: Evelyne Güntlisberger
Infos zu Amphibien:
Vielfalt statt Langweile
Verschiedene Lebensräume im Siedlungsraum sind nicht nur wichtig für die Biodiversität, sondern auch für die Lebensqualität des Menschen. Eine Safari vor der Haustüre lässt den Alltagsstress vergessen.
Eine neue Oase entsteht
Im Herbst 2019 hat der Natur- und Vogelschutzverein Wehntal im Dorfkern von Schleinikon beim Gemeindehausparkplatz eine Ruderalfläche angelegt. Ruderalflächen werden von spezialisierten Pflanzenarten, den sogenannten Pionierpflanzen, besiedelt. Diese sind wahre Hungerkünstler und kommen mit wenigen Nährstoffen aus. In Wiesen und anderen Lebensräumen mit dichter Pflanzendecke werden sie von konkurrenzstarken Arten verdrängt. Ruderalflächen können farbenprächtig sein und verändern ihr Erscheinungsbild von Jahr zu Jahr. Der Artenwechsel von Jahr zu Jahr ist typisch für Ruderalflächen. Ebenso ist vom frühen Frühling bis im Herbst für ein grosses und vielfältiges Blütenangebot gesorgt – ein wahres Eldorado für blütenbesuchende Insekten.
Lückige Bepflanzung – weniger ist mehr!
Im Gegensatz zu Wiesenpflanzen bilden Pionierpflanzen keine geschlossene Pflanzendecke, sondern lassen Lücken mit offenem Boden. An sonnigen Standorten bieten Ruderalflächen deshalb geschützte und warme Bodenstellen, wo Tiere wie Eidechsen oder Insekten sonnenbaden, sich aufwärmen oder nisten können. Die Stängel von mehrjährigen Pionierpflanzen sind oft hohl (z.B. Karde) oder markhaltig (z.B. Königskerzen). Wildbienen und anderen Insekten dienen sie als Nist- und Überwinterungsplätze. Ruderalflächen sollten deshalb nicht jedes Jahr gemäht werden.
Vernetzung
Damit sich mobile Tiere und Pflanzen ansiedeln können, braucht es ein engmaschiges Netz an naturnahen Flächen als Trittsteine, die untereinander verbunden sind. Zusätzlich braucht es eine Vernetzung mit dem Umland, damit die Landschaft für Tiere und Pflanzen durchlässig bleibt und Siedlungen keine unüberwindbaren Barrieren bilden. Helfen auch Sie mit und gestalten Ihren Garten naturnah.
Evelyne Güntlisberger, Natur- und Vogelschutzverein Wehntal
Hände weg von Jungvögeln!
Viele Jungvögel verlassen ihr Nest noch bevor sie richtig fliegen können. Doch auch ausserhalb des Nestes werden sie weiterhin von ihren Eltern gefüttert und umsorgt. Die Schweizerische Vogelwarte empfiehlt daher, Jungvögel dort zu lassen, wo sie sind.
Mit dem Beginn der Brutzeit werden die ersten scheinbar verwaisten Jungvögel in die Vogelpflegestation der Schweizerischen Vogelwarte eingeliefert. Diese gut gemeinte Hilfe ist aber in den meisten Fällen gar nicht nötig. Im Gegenteil: Oft führt sie dazu, dass gesunde Jungvögel von ihren Eltern getrennt werden.
Ein Jungvogel ist meist nur scheinbar alleine und hilflos. Er wird auch nach dem Verlassen des Nestes von seinen Eltern weiterhin gefüttert und betreut. Die Vogelwarte empfiehlt deshalb, Jungvögel grundsätzlich an ihrem Fundort zu lassen. Einschreiten soll man nur, wenn sich ein Vogel in unmittelbarer Gefahr befindet. Sitzt beispielsweise eine junge Amsel auf der Strasse, so kann man sie – auch mit blossen Händen – aufheben und ins nächste Gebüsch tragen. Dort werden die Altvögel sie auch weiterhin füttern. Ist hingegen ein Jungvogel verletzt oder wird er von den Eltern während mehreren Stunden nicht mehr gefüttert, bringt man ihn am besten in die nächstgelegene Pflegestation. Die Schweizerische Vogelwarte Sempach vermittelt gerne die entsprechende Adresse.
Was tun?
Verletzte und kranke Vögel sowie verlassene Jungvögel gehören in die Hände von Fachleuten! Die Schweizerische Vogelwarte Sempach betreibt eine eigene Pflegestation. Diese kann unter Tel. 041 462 97 00 und ohne Voranmeldung (Mo-Fr 8-12 Uhr und 13.30-17 Uhr) erreicht werden; an Wochenenden und Feiertagen ist ein Pikettdienst organisiert.
- Ratgeber der Vogelwarte Sempach: https://www.vogelwarte.ch/de/informieren/ratgeber/
- Verletzte Tiere, Tierrettungsdienst: https://www.tierrettungsdienst.ch
Evelyne Güntlisberger, Natur- und Vogelschutzverein Wehntal
Text: Schweizerische Vogelwarte Sempach
Haussperlinge (Spatzen) nisten gerne in Storenkästen
Dass sich der Sperling Storenkästen zum Nisten aussucht, hat damit zu tun, dass die moderne Bauweise kaum noch geeignete Nistplätze bietet, und bei Renovationen von alten Häusern werden Nischen verschlossen. Der Sperling gerät zunehmend in Wohnungsnot. Auch die Aussenraumgestaltung bietet mit immer mehr versiegelten Flächen und vielen exotischen Pflanzen deutlich weniger Nahrung in Form von Insekten und Sämereien. Dies führt dazu, dass die Bestände des Sperlings in vielen europäischen Ländern abnehmen. In England musste die Art sogar in die Rote Liste der gefährdeten Vogelarten aufgenommen werden. In der Schweiz sind die Bestände gebietsweise seit 1980 um 20 bis 40% zurückgegangen.
Sie können dem Sperling helfen, indem Sie alternative Nistmöglichkeiten anbieten - so können diese ausweichen und versuchen weniger, in die Storenkästen zu gelangen. Für den Spatz eignen sich Nistkästen für Höhlenbrüter also Meisen-Nistkästen.
Mit Blumenwiesen und einheimischen Büschen und Sträuchern kann das Nahrungsangebot in Form von Sämereien und Insekten in Gärten und öffentlichen Räumen wieder erhöht werden. Auf Pflanzenschutzmittel und andere Gifte sollte verzichtet werden. Von diesen Massnahmen profitiert nicht nur der Haussperling, sondern allgemein die Biodiversität im Siedlungsraum.
Sollten die Bemühungen mit alternativen Nistmöglichkeiten keinen Erfolg bringen, kann dem Einnisten in Storenkästen entgegengewirkt werden, indem die Storenkästen gegen das Nisten abgesichert werden. Am besten werden diese durch Fachpersonen (Storenbauer) professionell abgedichtet. So besteht keine Gefahr, dass sich ein Vogel durchzwängen oder an losen Drahtteilen hängenbleibt und verletzen kann. Dies sollte während den Wintermonaten geschehen, denn der Haussperling steht unter Artenschutz und es dürfen während Mitte März bis Mitte August keine Nistplätze entfernt werden.
Haben Sie Fragen oder Anregungen, steht Ihnen der Natur- und Vogelschutzverein Wehntal gerne unter info@vogelschutzverein.ch zur Verfügung.
Gummiband statt Regenwurm
Sei es auf dem Weg zum Bahnhof oder beim Spaziergang im Wald – überall treffe ich auf die Spuren der Zivilisation. Meist in Form von Plastikmüll oder aktuell, weggeworfenen Schutzmasken. Sei es aus Bequemlichkeit oder Unachtsamkeit, eigentlich wissen wir alle,
dass Abfall nicht in die Natur gehört.
Für Vögel sind insbesondere Schnüre und Fäden gefährlich, da sie sich darin verheddern können, was nicht selten zum Tod führen kann. Auch wird der vermeintliche Regenwurm, der in Tat und Wahrheit ein Gummiband ist, gerne an die Jungvögel verfüttert. Dies zeigt das Beispiel eines jungen Weissstorchs. Dieser wurde völlig abgemagert und erschöpft aufgefunden. In seinem Magen befanden sich nebst vier Käferflügeln, einem Stück Netz und einer Glasscherbe insgesamt 471 g Dichtungsringe, Schnüre und Gummibänder.
Tiere können sich an unserem Abfall verletzen oder vergiften. Plastikmüll zersetzt sich nicht vollständig und landet letztlich als Mikroplastik in unseren Gewässern.
Hier können wir alle etwas dazu beitragen. Nicht nur, indem wir den eigenen Abfall des Grillplauschs im Park oder im Wald konsequent fachgerecht entsorgen (das heisst, wieder mit nach Hause nehmen) – auch mit regelmässigen Kontrollen des eigenen Gartens auf herumliegende Schnüre sowie dem Auflesen von Abfall beim nächsten Spaziergang kann man etwas Gutes tun.
Was tun mit gefiederten Patienten?
Verletzte und kranke Vögel gehören in die Hände von Fachleuten. Im Zweifelsfall kann man sich telefonisch an die Vogelwarte wenden. Die Fachpersonen können abschätzen, welche Hilfe der Vogel braucht, und auch Tipps zum Transport oder zu nähergelegenen Pflegestationen geben. Tel: 041 462 97 00 bzw. www.vogelwarte.ch/pflegestation
Von einer Pflege zu Hause sei abgeraten. Die Haltung und Pflege einheimischer Vögel erfordert nämlich nicht nur Fachwissen und adäquate Haltungsbedingungen, sondern auch eine kantonale Bewilligung.
Evelyne Güntlisberger, Natur- und Vogelschutzverein Wehntal